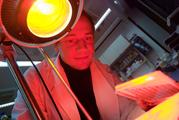PFLEGE
AWARDS
Forschergeist gefragt: 14. Novartis Oppenheim-Förderpreis für MS-Forschung ausgelobt
FernstudiumCheck Award: Deutschlands beliebteste Fernhochschule bleibt die SRH Fernhochschule
Vergabe der Wissenschaftspreise der Deutschen Hochdruckliga und der Deutschen Hypertoniestiftung
Den Patientenwillen auf der Intensivstation im Blick: Dr. Anna-Henrikje Seidlein…
Wissenschaft mit Auszeichnung: Herausragende Nachwuchsforscher auf der Jahrestagung der Deutschen…
VERANSTALTUNGEN
Wichtigster Kongress für Lungen- und Beatmungsmedizin ist erfolgreich gestartet
Virtuelle DGHO-Frühjahrstagungsreihe am 22.03. / 29.03. / 26.04.2023: Herausforderungen in…
Pneumologie-Kongress vom 29. März bis 1. April im Congress Center…
Die Hot Topics der Hirnforschung auf dem DGKN-Kongress für Klinische…
Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2023 startet am 14.3.
DOC-CHECK LOGIN
 Tut doppelt weh
Tut doppelt weh
Ursache von Schmerz bei der Behandlung von hellem Hautkrebs
Bochum (20. Juni 2012) – Salbe auftragen, Licht an, Licht aus – so leicht lassen sich verschiedene Formen von hellem Hautkrebs heilen. Allerdings leidet ein Großteil der Patienten an starken Schmerzen während der sogenannten Photodynamischen Therapie. Warum die Behandlung mit Salbe und Rotlicht so schmerzhaft sein kann, haben RUB-Forscher aufgedeckt. Sie identifizierten die beteiligten Ionenkanäle und von den Krebszellen ausgeschiedene Signalmoleküle. „Die Ergebnisse liefern möglicherweise einen Ansatzpunkt, den Schmerz zu unterdrücken“, sagt Dr. Ben Novak vom Lehrstuhl Tierphysiologie.
So funktioniert die Photodynamische Therapie
Krebszellen sind mit anderen Enzymen als gesunde Zellen ausgestattet und haben einen deutlich höheren Stoffwechsel. Trägt man die sogenannte Aminolävulinsäure in Form eines Gels auf die Haut auf, nehmen Krebszellen wesentlich mehr von diesem Stoff auf als gesunde Zellen. Reichert sich Aminolevulinsäure in den Zellen an, bilden die Mitochondrien – die Kraftwerke der Zellen – das Molekül Protoporphyrin IX. Mit Rotlicht bestrahlt reagiert Protoporphyrin IX mit Sauerstoff. Dabei entstehen hochreaktive Sauerstoffspezies, die freien Radikale, die die Krebszellen zerstören. Etwa 10 Minuten Rotlichtbestrahlung reichen aus, um oberflächlichen hellen Hautkrebs wie zum Beispiel die Aktinische Keratose erfolgreich zu behandeln. Auch Warzen entfernen Ärzte auf diese Weise.
Schmerzhafte Therapie
„Der Haken ist: Das tut furchtbar weh“, erzählt Ben Novak. 40 Prozent der Behandelten haben während der Lichtbestrahlung Schmerzen, die sie auf einer Skala von 0 bis 10 (wobei 10 einem Vernichtungsschmerz wie bei einem Herzinfarkt entspricht) bei 7 bis 8 einschätzen. Mit Injektionen, ähnlich wie beim Zahnarzt, lassen sich die beteiligten Nerven zwar betäuben. „Aber das ist auch immer mit einem Risiko verbunden“, so der Bochumer Biologe. Die Wissenschaftler um RUB-Professor Dr. Hermann Lübbert haben nun das Rätsel gelöst, warum die Behandlung überhaupt wehtut.
Schmerzempfindliche Zellen in der Haut werden angeregt
Der Schmerz entsteht gleich über zwei Mechanismen. In einem Zellkulturexperiment zeigte das Team, dass nicht nur Krebszellen, sondern auch schmerzempfindliche Nervenzellen in der Haut Aminolävulinsäure – und deren Abkömmling Methylaminolävulinsäure – aus der Salbe aufnehmen. Mit „Calcium Imaging“ verfolgten die Tierphysiologen die Aktivität von Nervenzellen, die sie mit Aminolävulinsäure behandelt hatten, und solchen Zellen, die dem Stoff nicht ausgesetzt wurden. Behandelte Nervenzellen feuerten, wenn die Forscher sie mit Licht bestrahlten. Im lebenden Organismus hieße das: Die Zellen senden einen Schmerzreiz ans Gehirn. Ohne Aminolävulinsäure blieben die schmerzempfindlichen Zellen unter Rotlicht inaktiv. In weiteren Experimenten zeigten die Wissenschaftler, dass die Aktivität der Nervenzellen auf Natrium-Kanäle und spannungsgesteuerte Calcium-Kanäle in der Zellmembran zurückgeht. „Ein Medikament, das an diesen Kanälen ansetzt, wäre denkbar, um den Schmerz zu unterdrücken – aber das liegt noch in der Zukunft“, sagt Ben Novak.
Tumorzellen alarmieren Nervenzellen
Lübberts Team stellte fest, dass Schmerz in den Nervenzellen selbst, aber auch noch auf einem anderen Weg entsteht. Die angegriffenen Tumorzellen scheiden ein Molekül aus – nämlich Acetylcholin. „So geben sie an andere Zellen die Information weiter: Hier stimmt was nicht, mir fliegen gerade die Mitochondrien um die Ohren“, veranschaulicht Novak. Acetylcholin fungiert im Nervensystem als Botenstoff und ist dort ungefährlich. „Frühere Studien haben aber ergeben, dass es sehr schmerzhaft ist, wenn man es in die Haut injiziert.“ Einige der Ergebnisse sind bereits publiziert. Die Daten zu den Mechanismen der Schmerzentstehung bereiten die Forscher gerade für die Veröffentlichung vor. Sie stießen auf großes Interesse auf dem 12. Kongress der europäischen Gesellschaft für Photodynamische Therapie (Euro-PDT) in Kopenhagen im Mai 2012.
Titelaufnahme
-
B. Novak, R. Schulten, H. Lübbert (2011): δ-Aminolevulinic acid and its methyl ester induce the formation of Protoporphyrin IX in cultured sensory neurons, Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, doi: 10.1007/s00210-011-0683-1
Angeklickt
-
RUBIN-Artikel zum Thema
http://www.ruhr-uni-bochum.de/rubin/rubin-fruehjahr-11/beitraege/beitrag10.html
Abb.: Zellen, die mit Aminolävulinsäure inkubiert werden, bilden Protoporphyrin IX (PpIX), das in der fluoreszenzmikroskopischen Aufnahme rot erscheint. Sowohl Nervenzellen (obere Reihe), als auch Hautkrebszellen (untere Reihe) bilden PpIX. Das linke Bild beider Reihen stellt eine Übersicht dar; die mittleren und rechten Bilder zeigen vergrößerte Ausschnitte der linken Bilder. Grün gefärbt sind die Kraftwerke der Nerven- und Krebszellen, die Mitochondrien. Die Färbemuster von PpIX und dem Mitochondrienfarbstoff ähneln sich. Das legt nahe, dass PpIX sich in den Mitochondrien ablagert. Abbildung: Ben Novak
Quelle: Ruhr-Universität Bochum, 20.06.2012 (tB).